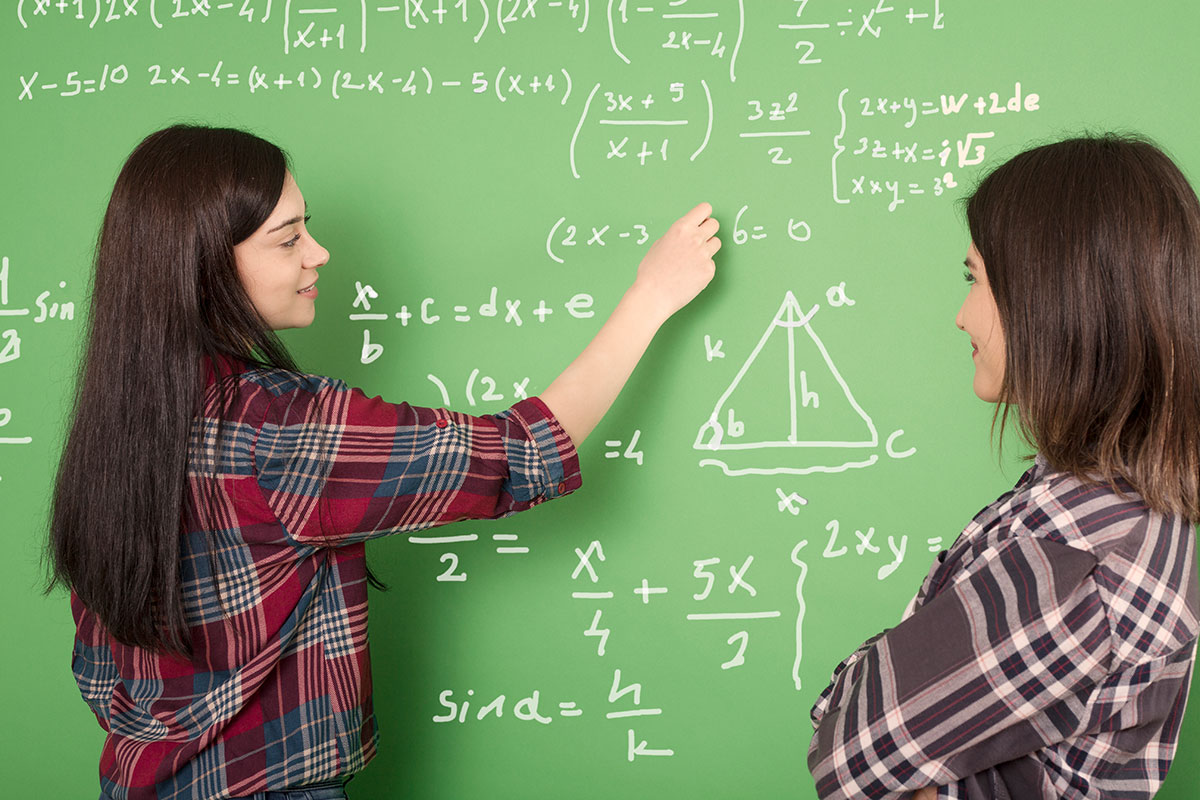Arbeitstechnische Fächer
Zum Erwerb der Lehrbefähigung für arbeitstechnische Fächer besuchen die Fachlehreranwärter*innen, gemeinsam mit den Studienreferendareninnen und Studienreferendaren, die Module der Allgemeinpädagogik und des jeweiligen Berufsfeldes. Die Modulinhalte der arbeitstechnischen Fächer sind allerdings ausschließlich auf die Anforderungen im fachpraktischen Unterricht ausgelegt und den Fachlehreranwärterninnen und Fachlehrern vorbehalten.
Der arbeitstechnische Unterricht an Berufsschulen ist im Wesentlichen durch seine hohe Handlungsorientierung geprägt.
Ein Schwerpunkt der Modularbeit liegt darin, unter der Beachtung methodischer und didaktischer Konzepte, möglichst reale Lernsituationen aus dem beruflichen Alltag zu generieren.
Außerdem soll durch eine gezielte Produktorientierung daraufhin gearbeitet werden, die Interessen der Lernenden zu berücksichtigen, um somit an ihre Lebenswelt anzuknüpfen und eine durchgängige Motivation aufrecht zu erhalten. Hierdurch sollen die Lernenden zum selbstständigen Handeln befähigt und ihnen eine daraus resultierende Kompetenzerweiterung ermöglicht werden.
Da der Unterricht zumeist in schulischen Werkstätten, Küchen oder Lernbüros stattfindet, liegt ein weiterer Schwerpunkt der Modularbeit darin, das sichere Unterrichten, unter Einhaltung des geltenden Arbeits- und Gesundheitsschutz, in den Fokus zu nehmen.
Biologie
Im Zentrum der Modulveranstaltungen steht die Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements für kompetenzorientiertes Unterrichten im Unterrichtsfach Biologie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lehrpläne.
Fachspezifische Methoden (z.B. Modellbau, Experimente) werden beleuchtet, um in Teams innerhalb der Modulveranstaltungen deren Einsatz für Unterrichtsplanungen zu nutzen. Die Lehrenden können entsprechend der eigenen Lerngruppe Teile dieser Unterrichtsplanung an der Ausbildungsschule anwenden. Die Durchführung und die gesammelten Erfahrungen werden in der Modulveranstaltung präsentiert und gemeinsam reflektiert.
Neben den naturwissenschaftlichen Methoden werden fachlich relevante schulrechtliche Regelungen (z.B. Gefährdungsbeurteilungen bei Experimenten, Wandererlass bei naturwissenschaftlichen Exkursionen), Digitalisierung im Biologieunterricht und die gesellschaftliche Relevanz des Faches Biologie berücksichtigt.
Die Ausbildung findet in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Kassel statt.
Deutsch
Aufgabe des Deutschunterrichts an beruflichen Schulen ist die Förderung der Kulturtechniken Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. Darüber hinaus ist der Deutschunterricht darauf gerichtet, die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, am kulturellen Leben in seinen vielfältigen Formen aktiv und verständig teilzunehmen und sie zum Nachdenken über das eigene Handeln und seine Voraussetzungen anzuregen. Diesem Nachdenken und der erwähnten aktiven und verständigen Teilnahme am kulturellen Leben in seiner Vielfalt dient in besonderem Maße die Beschäftigung mit Literatur.
Wie kann ein moderner Deutschunterricht aussehen, der diesen Anforderungen gerecht wird? Wie wählt man aus der Fülle an möglichen Inhalten und Methoden für die verschiedenen Schulformen angemessen aus? Wie kann man Schüler und Schülerinnen für Literatur begeistern? Wie können Schülerinnen und Schüler zu Betrachtungen von Sprache und ihrer Wirkung befähigt werden? Wie können digitale Medien kreativ genutzt werden?
Fragen dieser Art gehen wir nach, indem wir auf der Grundlage individueller Fragen aus der Unterrichtspraxis und verschiedener didaktischer und methodischer Konzepte gemeinsam Unterricht planen, Material erstellen, erproben und evaluieren.
Englisch
“The object of teaching a [student] is to enable him [or her] to get along without a teacher.”
― Elbert Hubbard (American writer, publisher, artist, and philosopher)
Die interkulturelle Handlungsfähigkeit ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die ein guter Englischunterricht vermitteln soll. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen lernen, ganz unterschiedliche fremdsprachliche Handlungssituationen selbstständig, selbstbewusst und kompetent zu bewältigen. Hierzu gehört nicht allein eine angemessene sprachliche Kompetenz in den klassischen Kompetenzbereichen listening, reading, speaking und writing. Auch die Vermittlung von personalen und sozialen Kompetenzen – wie etwa Empathie und Toleranz gegenüber anderen Kulturen sowie die Diskursfähigkeit, sich angemessen über Unterschiede auszutauschen bzw. sich mit anderen darüber auseinanderzusetzen – sind elementare Bestandteile eines modernen Englischunterrichts.
In den Modulen beschäftigen wir uns damit, wie Englischunterricht geplant, durchgeführt und ausgewertet wird. Wir gestalten hierzu auch gemeinsam schüler- und handlungsorientierte Unterrichtsarrangements und berücksichtigen dabei unterschiedliche fachdidaktische Ansätze für kompetenzorientiertes Unterrichten. Diagnose und Förderung spielen hier unter anderem ebenso eine Rolle wie verschiedene Methoden- und Medienkonzepte – ein Schwerpunkt liegt hier auch zunehmend auf den Möglichkeiten, die die fortscheitende Digitalisierung bietet.
Französisch
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden ausgebildet.
Sport
Vor dem Hintergrund der beruflichen Vielfalt und der unterschiedlichen Adressatengruppen an einer Berufsschule bilden die theoretische Auseinandersetzung sowie die sportpraktische Erweiterung der eigenen gesundheits- und freizeitsportlichen Kompetenz (Kompensations- und Motivationsfunktion) die Grundlagen der Module im Fach Sport.
Die LiV üben sich in der Planung, Organisation und Durchführung von Sportunterricht auf der Basis der geltenden Kompetenzen und Standards. Die Entwicklung eines Verständnisses für die Erfüllung des doppelten Bildungsauftrages der Sportpädagogik (Qualifizierung zum und durch Sport) ist dabei ein wichtiger Eckpfeiler. Eine Konzeption im Sinne eines anwendungs- und lebensweltbezogenen Unterrichts sowie die Vermittlung von Einstellungen und Werten für ein lebenslanges Bewegen und Sporttreiben spielen dabei eine besondere Rolle. Hierfür lernen die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst geeignete Diagnoseinstrumente kennen, um die Lernausgangslagen in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen zu erfassen und die berufsspezifischen Belastungspotentiale zu ermitteln. Einblicke in verschiedene sportpraktische Vermittlungsansätze und fachspezifische Arbeitsweisen stehen ebenso wie fachdidaktische und methodische Entscheidungen zur Leistungsbewertung im Fokus der Module.
Weiterhin entwickeln die LiV fachorientierte Kriterien für die Reflexion und Evaluation von Lehr- und Lernprozessen. Alle Überlegungen gründen dabei stets auf den curricularen Vorgaben bzw. Rahmenplanvorgaben sowie den besonderen schulrechtlichen Richtlinien für das Unterrichtsfach Sport.
Mathematik
Mathematik als interessant und sinnvoll erscheinen zu lassen, die Freude, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, und die Bereitschaft, Beziehungsarbeit zu leisten, so dass Lernende ganzheitlich in ihren Kompetenzen gefördert werden, können Motive sein, sich mit dem Unterrichtsfach Mathematik vielschichtig auseinanderzusetzen und den Beruf einer Mathematiklehrkraft anzustreben.
In den Modulen des Unterrichtsfachs Mathematik werden u. a. fachbezogene Diagnose- und Förderkonzepte, fachdidaktische Konzepte zur Leistungsbewertung, kompetenzorientierte Aufgabenformate und Übungsprinzipien, fachorientierte Kriterien für die Reflexion von Lernprozessen sowie fachdidaktische Grundpositionen für Lehr- und Lernprinzipien nach dem „Doppeldeckerprinzip“ (wir arbeiten im Seminar nach Prinzipien, die auch im Unterricht gelten) erarbeitet und erprobt. Ebenso werden aktuelle unterrichtliche Themen und fachlich relevante schulrechtliche Regelungen thematisiert.
Politik und Wirtschaft
„Nicht alles ist Politik, aber in Allem ist Politik“ so etwa hat es Willy Brandt einmal beschrieben. Dieser Grundgedanke leitet uns. In den Modulen „Politik und Wirtschaft“ ist der Schwerpunkt, die Anwendung verschiedener didaktischer Konzepte kennenzulernen. Dazu entwickeln wir in den Seminarveranstaltungen Lehr- und Lern-Arrangements für den Politikunterricht an den Ausbildungsschulen. Diese praktischen Erfahrungen werden dann gemeinsam in den Seminarveranstaltungen evaluiert. Darüber hinaus leiten uns folgende Fragestellungen:
Wie kann der Unterricht gestaltet sein, um junge Menschen für Politik zu begeistern?
Welche Kompetenzen können im Politikunterricht gefördert werden, um die Lernenden für die Berufswelt und das private/gesellschaftliche Leben fit zu machen?
Welche Möglichkeiten gibt es, die digitalen Medien zu nutzen und als Lehrkraft gemeinsam mit den Lernenden zu lernen?
Chemie
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Darmstadt ausgebildet.
Spanisch
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden ausgebildet.
Geschichte
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden ausgebildet.
Informatik
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Kassel ausgebildet.
Physik
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Kassel ausgebildet.
Ethik
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Darmstadt ausgebildet.
Evangelische Religion
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Kassel ausgebildet.
Katholische Religion
Wird in Kooperation mit dem Studienseminar für berufliche Schulen in Kassel ausgebildet.